BESTÄTIGUNG ÜBER DIE GESAMTHEIT EINES KLOSTERVERMÖGENS
König Soundso an den patricius1 Der patricius-Titel des Frankenreiches scheint, im Gegensatz zum oströmischen Reich, kein reiner Ehrentitel, sondern auf das Engste mit dem aus spätrömischer Zeit überdauerten Patriziat der Provence verbunden gewesen zu sein. In seinen Kompetenzen scheint der Patriziat dem Dukat vergleichbar gewesen zu sein. Vgl. dazu D. Claude, Niedergang, S. 363-376; I. Heidrich, Titulatur, S. 92f.; A. R. Lewis, The dukes, S. 389. Soundso und alle Beauftragten (agentes). Wir halten es für recht, dass wir auf Bitten von Bischöfen2 Der Begriff sacerdos ist in Spätantike und Frühmittelalter einer von sieben möglichen Titeln für den Bischof. Die Reihe presbyter, antistes, praesul, pontifex, sacerdos und papa findet man unter anderem bei Isidor, Etymologiae VII,12, 10-21 (ohne presbyter) und im sogenannten „Formelbuch Salomos III.“ Notkers des Stammlers († 912) (E. Dümmler, Das Formelbuch, XLV, S. 59f.). etwas, das den Stätten der Heiligen zum Vorteil gereicht, mit Christi Beistand3 Der Ausdruck praesul bedeutet hier nicht „Bischof“, sondern wird im Sinne von praepositus oder patronus als Apposition zu Christus gebraucht. Für das Frankenreich ist die Wendung u.a. auch in den Epistolae Austrasicae (z.B. Ep. 46: ad nos, Christo praesule, quae oportuna mandata sunt, renuntiantes uelociter...) belegt. ins Werk setzen.
Der vir venerabilis Soundso, Abt des Kloster Soundso, bat also den Ruhm unserer Herrschaft, dass wir, da dasselbe heilige Kloster mit Gottes Hilfe aus einer Schenkung durch unsere Vorfahren erbaut wurde4 Zu Klostergründungen durch merowingische und später karolingische Herrscher vgl. F. Prinz, Frühes Mönchtum, S. 152-230., die Gesamtheit seines Vermögens durch unsere Verordnung ganz und gar bestätigen mochten, sowohl das, was die Vorgänger des Abtes ebendort erarbeitet haben oder [was] der Herr Abt Soundso, von dem man weiß, dass er ebenda [Abt] gewesen ist, an der Habe des Klosters ebendort vermehrt oder erworben hat, [als auch] das, was derselbe heilige Ort derzeit besitzt.
Dass wir dies aus Ehrfurcht vor Gott und zur Erhöhung unseres Lohns gewährt haben, darf eure Hoheit nicht bezweifeln. Wir haben nämlich auch beschlossen, ein Privileg desselben Klosters, das sie durch eine Anordnung des [zuständigen] apostolischen Stuhls und weiterer Bischöfe erwarben, und das bekanntlich durch eine Urkunde des Herrn Soundso und durch weitere nachfolgende Könige, unsere Vorfahren, beschirmt wurde, für ewige Beständigkeit zu bekräftigen, entsprechend dem, von dem sie freilich anführen, dass es ihnen gegenüber [bereits] durch unsere vorangegangene Verordnung5 Als praeceptum wurden in der Spätantike öffentliche Verordnungen, insbesondere des Kaisers bezeichnet. Zumeist handelte es sich bei diesen um legislative Maßnahmen, seltener dagegen um einzelne Individuen betreffende Beschlüsse. Hielt sich dieses Verständnis auch in den frühmittelalterlichen Leges, so findet sich im Urkundenwesen praeceptum, alternativ gebraucht zu auctoritas, als Schlüsselbegriff für die einen Einzelbeschluss verkündende Herrscherurkunde. Vgl. dazu P. Classen, Kaiserreskript, S. 56-58; J. Gaudemet, Praeceptum, S. 261-263. angemahnt worden sei.
Wir befehlen daher, dass das gesamte Vermögen desselben Klosters durch diese Urkunde gestärkt ohne unrechtmäßigen Widerspruch von irgendjemandem in Gegenwart und Zukunft mit Christi Beistand6 Der Ausdruck praesul bedeutet hier nicht „Bischof“, sondern wird im Sinne von praepositus oder patronus als Apposition zu Christus gebraucht. Für das Frankenreich ist die Wendung u.a. auch in den Epistolae Austrasicae (z.B. Ep. 46: ad nos, Christo praesule, quae oportuna mandata sunt, renuntiantes uelociter...) belegt. daselbst dem Wachstum förderlich sei, sowohl das, was auch immer man durch königliche Schenkung oder als Geschenke von Privatleuten7 Als privati wurden seit der Antike Personen bezeichnet, die für sich in einem engeren Kreis lebten oder nur im eigenen Namen als Einzelperson sprachen, also kein öffentliches Amt innehatten. Im frühen Mittelalter konnte privatus damit in der sozialen Semantik auch auf den sozial niederen Status einer Person abzielen. Vgl. dazu P. v. Moos, Öffentlich und privat, S. 17-23. oder durch die Vorgänger des Abtes oder auch des Herrn Soundso, ebendort hinzugewonnen oder erworben hat, als auch das, was man freilich aus irgendwelcher Habe rechtmäßig zusammengetragen hat, [und] das, was auch immer die Herrschaft desselben heiligen Ortes derzeit bekanntermaßen irgendwo an Landgütern, Häusern, Unfreien, Weinbergen, Wäldern, Wiesen, Weiden und irgendwelchen beneficia8 Im Wortsinne „Wohltat“, „Gunstbezeugung“ oder „Gabe“ wurde beneficium seit dem 7. Jahrhundert zunehmend auch in Verbindung mit der prekariatischen Landleihe gebraucht und entwickelte sich in der Folge zum terminus technicus für die zeitlich befristete Landleihe zum Nießbrauch. Vgl. dazu É. Lesne, Les diverses acceptions, S. 5; B. Kasten, Beneficium, S. 253f.; P. Fouracre, The use of the term beneficium, S. 62 und 70f. in rechtmäßiger Weise besitzt. Dem fügen wir hinzu, dass es auch ein Privileg gibt, sowohl hinsichtlich des Einzuges eines Abtes, den die ganze Gemeinschaft aus sich heraus organisieren muss, nachdem der andere schied9 Die freie Wahl des Abtes durch die Gemeinschaft der Mönche war in der Regula Benedicti geregelt. Häufig wurde dieses Recht jedoch durch die Ansprüche der Klostergründer und -eigner wie auch der Bischöfe und Könige, den Abt zu bestimmen, eingeschränkt. Gegen diese Einschränkungen sollten Garantien wie diese die Unabhängigkeit des Klosters sicherstellen. Vgl. dazu P. Salmon, Labbé dans la tradition monastique, S. 22-33; B. Hegglin, Der benediktinische Abt, S. 45-49; F. Felten, Äbte und Laienäbte, S. 66f., als auch hinsichtlich der übrigen Dinge, das, was demselben Kloster auf Anordnung der Bischöfe seit den Zeiten des Soundso bis heute zugestanden und bis jetzt bewahrt oder auf [Anordnung] vorausgegangener Könige zu seinen Gunsten bestätigt wurde. Nachdem man allen überflüssigen Störungen durch irgendwelche [Leute] Einhalt gebot, sollen sie derart auch zukünftig mit Gottes Hilfe für alle Zeiten in diesem Zustand unter unserem Schirm10 Die Form sermone ist an dieser Stelle ein „falscher Freund“. Das sermone steht für ein sirmone (e/i Verwechslung) und ist von s(c)irmo (aus dem fränkischen/althochdeutschen scirm „Schutz“/„Schirm“) abgeleitet. Ein Zusammenhang mit der „Rede“ bzw. „Predigt“ besteht nicht. In dieser Bedeutung findet sich sermone auch bei Gregor von Tours (Gregor von Tours, Historiarum libri X, IX, 42). Im neunten Buch der „Zehn Bücher Geschichten“ zitiert er einen Brief der Radegundis († 587) in welchem sie ein Nonnenkloster in Poitiers „unter Schutz und Schirm“ des Königs stellt (sub sua tuitione et sermone). leben können. Und Ihr und Eure Nachfolger sollt bei Angelegenheiten desselben Klosters gerechte Hilfe leisten, bei denen es nötig sein wird, auf dass es ihnen gefallen möge, oft für unser Heil zu beten, und es euch darum zu unserer Gnade gereiche.
Und damit diese Verordnung11 Als praeceptum wurden in der Spätantike öffentliche Verordnungen, insbesondere des Kaisers bezeichnet. Zumeist handelte es sich bei diesen um legislative Maßnahmen, seltener dagegen um einzelne Individuen betreffende Beschlüsse. Hielt sich dieses Verständnis auch in den frühmittelalterlichen Leges, so findet sich im Urkundenwesen praeceptum, alternativ gebraucht zu auctoritas, als Schlüsselbegriff für die einen Einzelbeschluss verkündende Herrscherurkunde. Vgl. dazu P. Classen, Kaiserreskript, S. 56-58; J. Gaudemet, Praeceptum, S. 261-263. in festem Bestand fortdauern mag, haben wir entschieden, sie von eigener Hand zu bekräftigen.

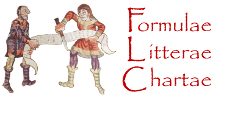

 Edition
Edition